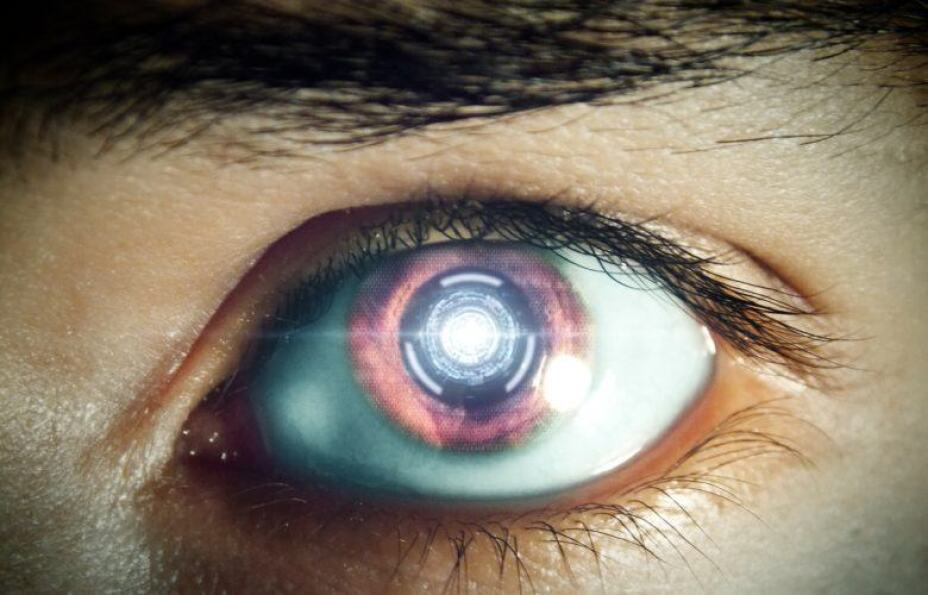Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. Wer nach dem Global Summit 2018 in San Antonio an unserem KI-Symposium teilgenommen hat, hat bereits unterschiedliche Anwendungsszenarien kennengelernt, in denen KI von Vorteil sein kann. Doch was braucht man für die Entwicklung KI-basierter Anwendungen wirklich? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich Ihnen ein aussagekräftiges Beispiel aus dem realen Leben vorstellen.

Das hier ist Monique. Wie man auf dem Bild sieht, arbeitet sie am Laptop und hält Vorträge.
Das ist auf den ersten Blick nichts Besonderes.
Zum ersten Mal habe ich Monique vor ein oder zwei Monaten im Fernsehen gesehen und dabei einige Dinge über sie erfahren, die Ihre Sichtweise möglicherweise verändern werden. Denn Monique ist blind. Als Kleinkind litt sie an einem kongenitalen Glaukom, das ihren Sehnerv gelähmt und ihr das Augenlicht genommen hat. Doch das hat ihren Optimismus, ihre Kontaktfreudigkeit und ihren Unternehmergeist keineswegs geschmälert. So hat sie unter anderem als Empfangsdame und Autorin gearbeitet und hält Vorträge vor unterschiedlichen Zielgruppen. Bei ihren Vorträgen hat sie immer ihren Laptop dabei, den sie mit beeindruckender Effizienz bedient. Dabei verwendet sie ein Gerät, das Texte laut vorliest. Und sie nutzt die Blindenschrift. Das einzige, was ihr trotzdem verwehrt bleibt, ist die genaue Ausrichtung des Projektors, den sie immer dabei hat.
Fotografieren, obwohl man blind ist
Und sie hat eine große Leidenschaft: die Fotografie. Sie führt einen Blog auf Facebook und diskutiert gern mit ihren Fans, wenn sie Artikel oder Beiträge verfasst oder Fotos veröffentlicht, die sie mit ihrem Handy gemacht hat (das sie genauso mühelos bedienen kann wie Sie und ich). Doch leider ist das Fotografieren nicht gerade einfach, wenn man blind ist. Und genau an dieser Stelle kommen das Fernsehen und letztlich auch künstliche Intelligenz ins Spiel.
In der Fernsehsendung, die von einem Comedian und einem Wissenschaftler moderiert wird, entwickelt eine Gruppe von „Makern“ Lösungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, um sie bei alltäglichen Aufgaben zu unterstützen. In dieser Folge ging es um Monique und die Frage, wie die „Maker“ dabei helfen können, ihre Herausforderungen beim Fotografieren zu meistern.
Der „Maker“ in dieser Folge war eine Softwarearchitektin, die aus verschiedenen KI-Diensten und anderen mehr oder weniger komplexen Funktionen eine App zusammengestellt hat.
- Zunächst hat sie die im Gerät verbauten Gyroskopsensoren genutzt, um zu überprüfen, ob sich das Handy in senkrechter Position befindet. Je nach Neigungswinkel erzeugt die App einen Signalton in einer bestimmten Höhe. Das ist noch nicht wirklich künstliche Intelligenz, hilft Monique aber schon dabei, schlecht ausgerichtete Fotos zu vermeiden, was ihr vorher immer recht schwer gefallen ist.
- Außerdem misst die App Helligkeit und Kontrast, damit die Bilder nicht zu dunkel oder zu hell ausfallen oder bei Gegenlichtaufnahmen nur Umrisse zu erkennen sind. Auch das ist noch nicht wirklich KI, geht aber schon etwas weiter als das Auslesen von Sensordaten. Wie bei der Neigungskontrolle gibt auch hier ein Signalton einen Hinweis, wenn das Bild möglicherweise schlecht belichtet sein könnte.
- Die größte Leistung war die Einbettung einer KI-Technologie, die Gegenstände erkennen kann. Wenn man die Kamera auf eines von mehreren Hundert Objekten richtet, auf die sie trainiert wurde, liefert sie in Echtzeit Informationen wie „kleine Flasche neben Laptop“ oder „Person unten rechts“. Das mag zunächst etwas unheimlich sein, ist für Monique aber ein enormer Vorteil.
- Eine weitere wichtige Funktion der App ist die Gesichtserkennung. Wenn man jemanden mehrmals fotografiert und der App den Namen der abgebildeten Person mitteilt, erkennt sie diese auch auf anderen Bildern. Ein besonderer Vorteil für Monique ist, dass die App die Namen der abgelichteten Personen in den Metadaten speichert. So kann sie ihre eigene Bilddatenbank leichter durchsuchen und sich ihre Erinnerungen an das Ereignis später wieder ins Gedächtnis rufen.
Insgesamt also eine sehr intelligente App. Was ist für uns als Lösungsanbieter im Bereich KI nun das Entscheidende an der ganzen Sache? Die Tatsache, dass die App komplett mit dem Budget eines öffentlichen Fernsehsenders aus Belgien und der freiwilligen Arbeit einer Softwarearchitektin entwickelt wurde, die ihre Freizeit für das Projekt geopfert hat. Das ist doch interessant. Denn hier hat nicht etwa irgendein Internetgigant aus dem Silicon Valley ein neues Projekt zum maschinellen Lernen aus dem Boden gestampft. Vielmehr kam eine Kombination bereits vorhandener Verfahren, Programmierschnittstellen und Dienste zum Einsatz. Es stimmt zwar, dass einige dieser Dienste von einem großen Anbieter aus Seattle gehostet wurden. Entscheidend ist aber, dass die App von Monique zusammengestellt und nicht entwickelt wurde.
Mit neuem Entwicklungsansatz zum Erfolg
Dieses Entwicklungsparadigma, das sich auf vorhandene API und Dienste stützt, anstatt alles von Grund auf neu zu entwickeln, ist nichts Neues. Vielmehr bildet es das Kernstück von serviceorientierten Architekturen, Microservices und Low-Code-Entwicklung. Bei dieser Arbeitsweise kommt es entscheidend auf die Interoperabilitätsfähigkeiten einer Plattform an. Im Kontext der künstlichen Intelligenz gewinnt dieses Entwicklungsparadigma zunehmend an Bedeutung, wie man es etwa bei PAPIs oder von großen Cloudanbietern wie Amazon, Google und Microsoft oft hört.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass man für die Entwicklung herausragender KI-basierter Apps keineswegs ein Großaufgebot von Datenexperten braucht. Wenn Sie Projekte in mehrere Teile zerlegen, finden Sie unter Umständen bereits vorhandene APIs, SDKs und Dienste, die Sie weit bringen. Und alles, was Sie brauchen, sind eine gute Entwicklungskompetenz, eine robuste Interoperabilitätsplattform und ein bisschen Fantasie, um Ihre Kunden mit KI-basierten Apps zu begeistern.
Folgen Sie Benjamin auf Twitter unter @benjamindeboe.